Sie haben einen geliebten Menschen verloren und müssen sich nun mit der rechtlichen Abwicklung des Erbes befassen. Oder Sie möchten für den Fall Ihres Ablebens den Nachlass regeln.
Dies kann für jemanden, der sich mit dem österreichischen Erbrecht nicht auskennt, eine unglaublich schwierige Angelegenheit sein – und Sie wissen daher vielleicht nicht, wo Sie anfangen oder was Sie unternehmen sollen. Der erste Schritt: Konsultieren Sie einen spezialisierten Rechtsanwalt für Erbrecht.
Wir sind hier, um zu helfen
Unsere Anwälte haben jahrzehntelange Erfahrung im Erbrecht und führen Sie Schritt für Schritt durch das Verfahren. Wir helfen Ihnen, Ihre Rechte zu verstehen und stellen sicher, dass alles nach Ihren Wünschen geregelt wird.
Unsere Kanzlei vertritt und berät seit Jahrzehnten erfolgreich Personen bei der Errichtung von letztwilligen Verfügungen, bei der Regelungen der Vermögensübergabe generell sowie bei diversen Fragen betreffend erbrechtliche Angelegenheiten. Wir helfen Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer erbrechtlichen Ansprüche und regeln die Übertragung von Vermögenswerten.
Rechtsanwalt für Erbrecht - unsere Leistungen
Erstellung eines (form)gültigen Testaments
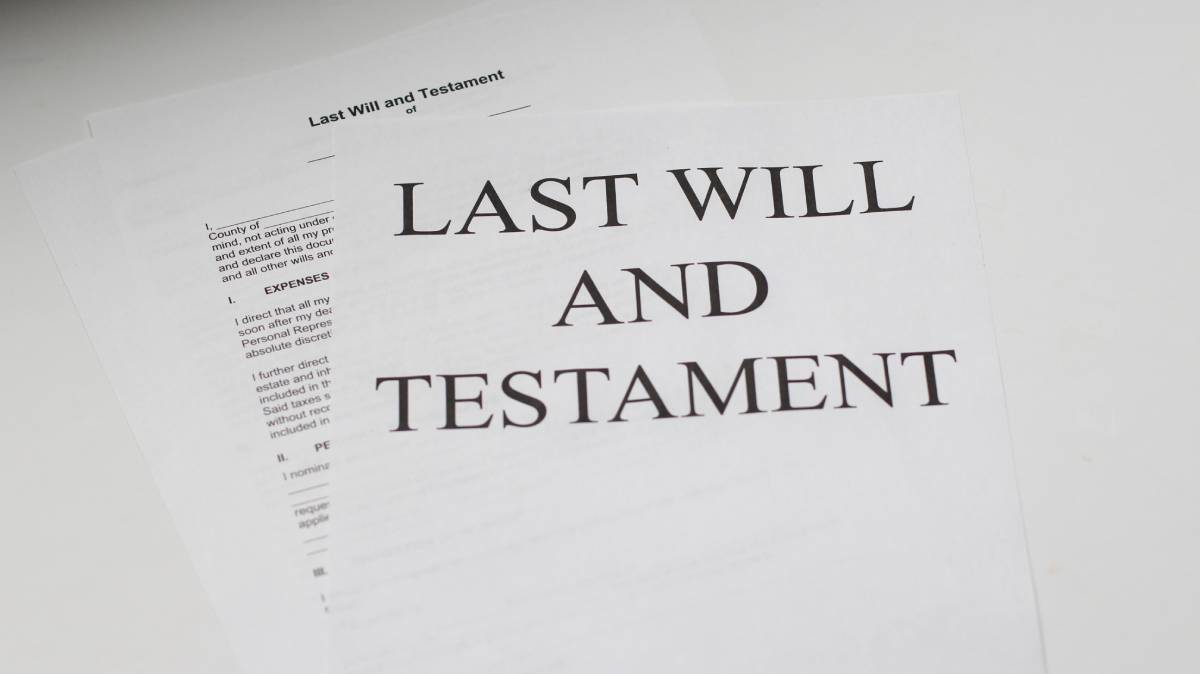
Wir erstellen für Sie ein gültiges Testament, das allen Anforderungen des österreichischen Erbrechts entspricht. So stellen Sie sicher, dass Ihre Wünsche nach Ihrem Ableben umgesetzt werden und es keine Streitigkeiten oder Kontroversen über Ihren Nachlass gibt.
Anfechtung unwirksamer oder ungültiger Testamente
Wenn Sie in einem Testament nicht bedacht wurden oder glauben, dass das Testament ungültig ist, helfen wir Ihnen, es anzufechten. Wir beurteilen die Situation und geben Ihnen eine ehrliche Meinung über Ihre Erfolgsaussichten. Wenn wir Ihren Fall übernehmen, werden wir alles tun, um Ihnen dabei zu helfen, den Ihnen zustehenden gerechten Anteil am Nachlass zu erhalten.
Geltendmachung von Pflichtteilansprüchen
Beim Pflichtteil handelt es sich um einen festen Prozentsatz des Nachlasses, der an bestimmte Verwandte gehen muss, auch wenn im Testament etwas anderes steht. Wenn Sie einen Pflichtteilsanspruch haben, helfen unsere Anwälte Ihnen, diesen Anspruch geltend zu machen. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in diesem Rechtsgebiet und sorgen dafür, dass Ihre Rechte umfassend gewahrt werden.
Regelung der Vermögensübergabe
Sie möchten sicherstellen, dass Ihr Vermögen nach Ihrem Tod nach Ihren Wünschen übertragen wird? Auch dabei können unsere Anwälte Ihnen helfen. Wir beraten Sie, wie Sie Ihren Nachlass am besten strukturieren können, setzen ein rechtsverbindliches Testament auf und stellen sicher, dass alles nach Ihren Wünschen gehandhabt wird.
Beratung in verschiedenen Fragen zu erbrechtlichen Ansprüchen

Wenn Sie sich über Ihre Rechte nach österreichischem Erbrecht unsicher sind, können unsere Anwälte helfen. Wir beraten Sie in einer Vielzahl von Angelegenheiten, darunter:
- Wie man ein Testament verfasst
- Wie man Vermögen überträgt
- Wie man eine Erbschaft anfechten kann
- u.v.m.
Unsere Anwaltskanzlei vertritt und berät seit Jahrzehnten erfolgreich Privatpersonen in diesen Angelegenheiten. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Anliegen so schnell und effizient wie möglich zu lösen, Streitigkeiten zu vermeiden und das Erbe zu erhalten, das Ihnen zusteht.
Ihr Anwalt für Erbrecht - Dr. Peter Hajek
 Dr. Peter Hajek, Anwalt für Erbrecht, praktiziert seit über 20 Jahren und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in diesem Rechtsgebiet. Sein beruflicher Werdegang und seine Qualifikationen machen ihn zum idealen Partner, um Sie bei Ihren erbrechtlichen Fragen zu unterstützen.
Dr. Peter Hajek, Anwalt für Erbrecht, praktiziert seit über 20 Jahren und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in diesem Rechtsgebiet. Sein beruflicher Werdegang und seine Qualifikationen machen ihn zum idealen Partner, um Sie bei Ihren erbrechtlichen Fragen zu unterstützen.
Über 20 Jahre Erfahrung als Fachanwalt für Erbrecht
Dr. Peter Hajek hat über 20 Jahre Erfahrung darin, Menschen bei der Beilegung von Erbstreitigkeiten zu helfen. Er verfügt über das nötige Wissen und die Erfahrung, um Ihnen zu dem Ergebnis zu verhelfen, das Ihnen nach dem Erbrecht zusteht.
Umfassende Kenntnisse des österreichischen Erbrechts
Wenn Sie mit einer Erbschaftsstreitigkeit konfrontiert sind, ist es wichtig, einen Anwalt zu haben, der mit dem österreichischen Erbrecht absolut vertraut ist. Dr. Peter Hajek verfügt über ein umfassendes Wissen in diesem Rechtsgebiet und wird Sie kompetent durch das Verfahren führen.
Häufig gestellte Fragen zum Erbrecht
An dieser Stelle beantworten wir einige der am häufigsten gestellten Fragen unserer Mandanten. Vielleicht ist auch Ihre Frage dabei.
Wo kann ich mich über Erbrecht informieren?
Das Erbrecht ist ein sehr umfangreiches Thema, es empfiehlt sich daher, sich im Bedarfsfall umfassend zu informieren. Informationen zum Erbrecht in Österreich erhalten Sie auf der Website der Österreichischen Rechtsanwaltskammer. Dort finden Sie detaillierte Informationen über das Erbrecht in Österreich sowie ein Verzeichnis von Rechtsanwälten, die sich auf dieses Rechtsgebiet spezialisiert haben. Des Weiteren können Sie sich auf die Anwaltssuche machen, um Anwälte in Ihrer Nähe zu konsultieren...
...oder, Sie können auch gerne einen Termin für eine Rechtsberatung für Erbrecht in unserer Kanzlei vereinbaren – wir sind spezialisiert auf Erbrecht.
Wer ist in Österreich erbberechtigt?
In Österreich sind die folgenden Personen gesetzlich erbberechtigt:
- Die Ehegattin/der Ehegatte oder eingetragene Partner des/der Verstorbenen
- Die Nachkommen des/der Verstorbenen
- Die Eltern des/der Verstorbenen und deren Nachkommen
- Die Großeltern des/der Verstorbenen
- Die Urgroßeltern des/der Verstorbenen
In Österreich richten sich die gesetzlichen Erben nach dem Verwandtschaftsgrad. Die engsten Verwandten haben den ersten Anspruch auf das Erbe, gefolgt von den entfernteren Verwandten. Wenn es keine Verwandten gibt, fällt der Nachlass unter Umständen an den Staat.
Ist es möglich, ein Testament in Österreich anzufechten?
Ja, es ist möglich, ein Testament in Österreich anzufechten. Wenn Sie der Meinung sind, dass das Testament nicht gültig ist oder Sie zu Unrecht nicht bedacht wurden, können Sie das Testament bei Gericht anfechten. Sie sollten mit einem erfahrenen Anwalt sprechen, um Ihre Möglichkeiten zu erörtern und zu klären, ob es sinnvoll ist, das Testament anzufechten.
Wie lange dauert das Verfahren zur Anfechtung eines Testaments in Österreich?
Das Verfahren zur Anfechtung eines Testaments in Österreich kann mehrere Monate oder sogar Jahre dauern. Es hängt von der Komplexität des Falles ab. Wenn Sie erwägen, ein Testament anzufechten, sollten Sie mit einem erfahrenen Rechtsanwalt sprechen, der Ihnen einen Überblick über die voraussichtliche Dauer des Verfahrens geben kann.
Wie ist das Verfahren für die Geltendmachung eines Erbteils in Österreich?
Das Verfahren für die Geltendmachung einer Erbschaft in Österreich hängt von der Größe und Komplexität des Nachlasses ab. Wenn der Nachlass klein ist und es keine Streitigkeiten gibt, kann das Verfahren relativ einfach sein und außergerichtlich erledigt werden. Ist der Nachlass jedoch groß oder gibt es Unstimmigkeiten unter den Erben, kann das Verfahren komplexer und zeitaufwendiger sein. In solchen Fällen ist der Weg vor Gericht oftmals nicht zu vermeiden.
Was sind die Gründe für eine Erbschaftsanfechtung in Österreich?
Es gibt mehrere Gründe, aus denen Sie eine Erbschaft in Österreich anfechten können, unter anderem:
- Das Testament ist aufgrund eines Formfehlers nicht gültig
- Der Verstorbene hatte nicht die geistige Fähigkeit, ein Testament zu errichten
- Das Testament wurde unter Zwang errichtet
Wenn Sie glauben, dass einer dieser Gründe auf Ihren Fall zutrifft, sollten Sie uns kontaktieren, um Ihre Möglichkeiten zu besprechen.
Aktuelles aus dem Erbrecht
-
01.02.2022
Vorbehalt des Fruchtgenusses schiebt Bewertungszeitpunkt nicht hinaus
geschrieben von HBW
Der Wert einer hinzurechnungspflichtigen Schenkung ist für den Zeitpunkt der tatsächlichen Durchführung (Vermögensopfertheorie) zu ermitteln und bis zum Todeszeitpunkt nach dem VPI anzupassen. Anders als nach Rechtsprechung zur Rechtslage vor dem ErbRÄG 2015 schiebt der Vorbehalt eines Fruchtgenussrechtes durch den Erblasser den Bewertungszeitpunkt der Schenkung nicht auf den Todeszeitpunkt hinaus (OGH 28.09.2021, 2 Ob 111/21v).
-
01.02.2022
Auskunftsanspruch über Schenkungen
geschrieben von HBW
Hinzurechnungsberechtigte, insbesondere Pflichtteilsberechtigte, haben einen Auskunftsanspruch über Schenkungen, der sich gegen die Verlassenschaft, die Erben oder die Geschenknehmer richtet. Bereits bekannte hinzurechenbare Zuwendungen an einen Pflichtteilsberechtigten stellen ein ausreichendes Indiz für weitere Zuwendungen an diese Person dar, welche einen Auskunftsanspruch begründen (OGH 17.11.2020, 2 Ob 227/19z).
